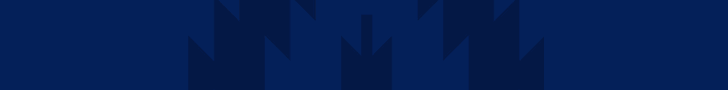Newsletter
Ein Team wird stark durch die Intelligenz der Vielfalt
Selbst die Nationalteams werden immer transnationaler und multikultureller. -- Dass sich die grossen europäischen Clubmannschaften die besten Spieler auf allen Kontinenten suchen, daran haben wir uns längst gewöhnt. Ebenso, dass beim französischen Meister Paris nur noch ein Franzose und in der Zeit vor Leicester beim britischen Meister manchmal nur noch ein oder zwei Briten spielten. Doch nun werden auch die Nationalmannschaften immer transnationaler. Die (west-)europäischen Einwanderungsgesellschaften bekommen eigentliche Multikulti-Nationalteams. Je erfolgreicher sie spielen, desto mehr.

Acht Jahre alt war Miroslav Klose aus dem oberschlesischen Opole in Polen, als er 1986 das erste Mal im pfälzischen Kusel vor einem deutschen Supermarkt stand. Hilflos, wie er sich erinnert. Denn er wollte sich ein Wägelchen zum Einkaufen ergattern und wusste nicht wie. «Da stellte ich mich etwas auf die Seite, beobachtete, wie es die anderen machten, und sah, dass man da ein D-Mark-Stück reinwerfen muss», erzählte Klose fast 30 Jahre später der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese hatte ihn nach Berlin eingeladen. Denn aus dem aufmerksamen Emigrantenkind Klose war ein deutscher Fussball-Weltmeister und der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft geworden.
Kurz nach der Bewältigung seines Problems beim Einkaufen im Supermarkt trat Miroslav Klose dem Fussball-Verein SG Blaubach-Diedelkopf bei. Für dessen Junioren schoss er während elf Jahren insgesamt 71 Tore – mehr als jeder Einheimische in der Geschichte des Dorfclubs in der westlichen Pfalz, den es heute nicht mehr gibt. Die Absicht, Schreiner zu werden, gab Miroslav auf. Fussball wurde sein Beruf und seine Zukunft. Sein damaliger Jugendtrainer Dieter Schmolke: «Er war relativ schmächtig und dadurch natürlich körperlich in diesem Alter vielen anderen unterlegen, was er aber mit seiner Technik und seinem vor allem schon damals prägnanten Kopfballspiel sehr ausgleichen konnte.» Auf Blaubach-Dielkopf folgten 1998 für Klose Homburg (33 Spiele, 11 Tore) und 1999 Kaiserslautern (170 Spiele, 70 Tore), Werder Bremen (89 Spiele, 53 Goals) und Bayern München (98 Spiele, 24 Tore) und seit fünf Jahren nun Lazio Rom (139 Spiele, 54 Tore). Noch wichtiger: 2001 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft. Als Klose 137 Spiele später 2014 als Weltmeister von ihr zurücktrat, hatte er nicht weniger als 71 Tore für das deutsche Team erzielt – mehr als irgendein anderer deutscher Fussballer. Ebenso schoss keiner an Weltmeisterschaften mehr Tore als Klose (16).
Spielend integriert
Doch all diese Tore und seine Ausnahmeleistungen allein hätten Mirsolav Klose nicht nach Berlin zur Ehrung durch die Bundeskanzlerin gebracht. Die Goldene Victoria der Deutschlandstiftu
Lukas Podolski (31) gehört zum gleichen Einwanderungs-Typ wie Klose, stammt wie er aus Polen, genauer dem ostschlesischen Gliwice. Er zog mit seinen Eltern bereits als Zweijähriger nach Köln; früh genug, um echt Kölsch sprechen zu lernen – mittlerweile hat er unter den aktiven deutschen Nationalspielern nicht nur die meisten Berufungen erhalten und am meisten Tore erzielt, sondern ist auch die Stimmungskanone im Team.
Klose und Podolski waren aber vor zehn Jahren alles andere als repräsentativ für die Emigranten Deutschlands. Das waren schon damals seit langem die Türken. Doch deren Fussball-Talente fanden erst nach der Reform der deutschen Juniorenarbeit die Wege an die Spitze. Deren Beste und 2014 Weltmeister sind heute Mesut Özil (27 Jahre alt) und Ilkay Gündogan (25) sowie der Nachwuchsstar Imre Can (22), aller drei Eltern waren aus der Türkei eingewandert. Oder: Jerome Boateng (27) ist in Berlin als Sohn einer deutschen Mutter und eines ghanaischen Vaters aufgewachsen, Ersatz-Captain Sami Khedira (29) tunesisch/deutscher Doppelbürger sowie Kami Bellarabi (26) marokkanisch/deutscher Doppelbürger. Nationalmannschafts-Manager Olivier Bierhoff fördert die spielerische Integration der Deutschen ohne deutsche Wuzerln seit Jahren. Begründung: «Natürlich bringen Spieler, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, andere Charaktere mit, einen anderen Spielwitz, eine andere Lebensphilosophie, und das bereichert uns.» Die These von Jogi Löw und Bierhoff: «Aus der Mischung entsteht sportliche Stärke!»
Vorbild dieses deutschen Gesinnungswandels waren die traditionell vielfältigen, bewunderten Nationalteams von Frankreich und Holland. Vor allem die französischen Weltmeister von 1998, die erste Equipe mit Spielern aus allen Kontinenten der Welt, hatte mit einer Ausnahme – Rechtsaussen-Politiker Jean-Marie Le Pen beklagte sich über die mangelnde Inbrunst beim Absingen der Marseillaise – alle entzückt. Aus les bleus – die französische Nati spielt traditionell immer in blau – war Black, Blanc, Beur geworden, in Anlehnung an die Hautfarben der Spieler. Beurbezeichnet die in Frankreich geborenen Kinder aus dem Maghreb, den ehemaligen Kolonien Frankreichs in Nordafrika. So kommen die Eltern des in Marseille geborenen vergötterten Kapitäns Zinedine Zidane (Zizou) – heute Trainer von Championsleague-Sieger Real Madrid – aus Algerien. Afrikanischer Abstammung waren auch Marcel Desailly (Ghana) und Patrick Vieira (Kap Verden), von den französischen Antillen mit den Übersee-Departements Guadeloupe und Martinique kamen Bernard Diomède und der vielfache Torschütze Thierry Henry, aus Französisch-Guayana Bernard Lama; Christian Karemberg kam von der südpazifischen Insel Neu-Kaledonien; argentinische Wurzeln hatte David Trezeguet, portugiesische Robert Pires, spanische der Torhüter Fabien Barthez sowie armenische Youri Djorkaeff!
Die Weltmeister aus Frankreich symbolisierten also nicht nur die Kinder verschiedener Einwanderer, sondern auch die alte Kolonialmacht Frankreich. Wobei Frankreichs Fussball schon früh vor allem von Arbeiterkindern gespielt wurde. So zeigten sich früh in den Mannschaften aus den Kohlen-, Eisen- und Stahlbauzentren wie Lille, Lens, Metz, Nancy oder St-Etienne die Kinder aus den Immigrantenfamilien aus Polen (in den 1950er-Jahren machten diese nicht weniger als 10 % aller französischen Fussballprofis aus), Italien, Nordafrika und anderen Kolonien.
Die Equipe Nationale verdankte grosse Erfolge schon lange diesen Einwandererkindern. So waren die Stars der Tricolore, die 1958 an der WM in Schweden Dritte wurden, Einwandererkinder aus Polen (Raymond Kopa, Maryan Wisnieski, Stephan Bruey), Italien (Roger Piantoni, Bernard Chiarelli), Ukraine (Kazimir Hnatow), Spanien (Claude Abbes) und Nordafrika (Just Fontaine und Célestin Oliver). Die französischen Europameister von 1984 und WM-Halbfinalisten von 1982 und 1986 spielten alle unter dem Captain und Künstler Michel Platini, ein Enkel italienischer Einwanderer wie seine Kollegen Battiston, Ferreiri und Bellone. Spanische Wurzeln hatten Luis Fernandes, Manuel Amoros und der Mittelfeld-Stratege Alain Giresse, aus Nordafrika stammten Goali Larios, Soler und Lopez, aus Schwarz-Afrika Jean Tigana und José Touré, aus den französischen Überseegebieten Marius Tresor, Alain Couriol und Jacques Zimako. Aus Polen, aus dem in den 1960er und 1970er-Jahren kaum mehr Arbeiter nach Frankreich ausgewandert waren, kam nur noch der freilich nicht weniger berühmte und talentierte Yannick Stopyra.
Die heutige Equipe Tricolore ist nicht weniger transnational und zählt zu Hause an der EM mit den Deutschen wieder zu den heissesten Favoriten. Die meisten sind in Frankreich als Söhne immigrierter Eltern geboren und spielen in den grossen Vereinen Europas – ausserhalb Frankreichs: Paul Pogbas (23) Eltern kommen aus Guinea, er spielt bei Juventus Turin. Die Eltern von Kingsley Coman (20, Bayern München) und Anthony Martial (20, Manchester United) stammen aus Guadeloupe, jene von Patrice Evra (35, Juventus) und Bacary Sagna (33, Manchester City) aus dem Senegal. Der Vater von Raphael Varane (23, Real Madrid) kommt von der Insel Martinique, N’Golo Kante (25, Leicester) ist malischer Herkunft, Eliaquim Mangala (25, Manchster City) hat sowohl einen kongolesischen, belgischen wie französischen Pass.
Heisst dies nun, dass alle diese transnationalen Nationalteams Ausdruck perfekt integrierter multikultureller Einwandergesellschaften sind? Nein, meint der französische Soziologe Patrick Mignon: «Integration per Fussball ist eine Illusion. Für einige Politiker an der Macht schien es die Wunder-Lösung. Doch der Rassismus schwelt auch in Frankreich nach wie vor.» Der rechtsextreme, fremdenfeindliche Front National droht bei den nächsten Wahlen die stärkste Partei zu werden. Und die Ghettos mit den vielen arbeitslosen Immigranten-Kindern illustrieren die Grenzen dessen, was in Frankreich mit dem Sport integrativ möglich ist. Bemerkenswert ist in Frankreich viel mehr, dass seit dem WM-Team von 1998 Frankreich zu seiner kulturellen Vielfalt steht, sie als Stärke und Quelle des Reichtums erkennt und sich vom alten Trugbild der einen und einheitlichen Nation verabschiedet.
Und doch gilt es festzuhalten, dass der Sport wie wohl sonst nur die Musik Fremden den Einstieg und den Zugang zur Mehrheitsgesellschaft erleichtert, sie schneller Anerkennung und Bestätigung finden lässt als anderswo, ihnen also die Integration erleichtert. Doch steht dieser schnelle Zugang eben nur jenen offen, die auch über entsprechendes Talent und Durchhaltevermögen verfügen – Eigenschaften, die unter Einheimischen wie Zugewanderten leider nicht allen gegeben sind.
Die gleiche Ambivalenz lässt sich auch am Beispiel Holland zeigen. Auch dort sind es die Kinder aus den Kolonien Zugewanderter, die seit Jahrzehnten den fussballerischen Ruhm des Oranje-Teams ausmachen. Die Väter von Ruud Gullit (Captain der niederländischen Europameister von 1988) und Frank Rijkaard kamen Ende der 1950er-Jahre zusammen aus Surinam nach Amsterdam, kurz bevor die alte Kolonie in Lateinamerika unabhängig wurde. Später folgten mit Kluivert, Davids und Seedorf weitere Einwanderer mit Namen, die kein Fussballfan vergisst. Heute sind es mehr Einwandererkinder aus Marokko und der Türkei – Khalid Boulahrouz und Inbrahim Afellay – welche den holländischen Fussball bereichern, auch wenn sie es diesmal nicht an die EM geschafft haben. Doch offiziell hat sich die holländsiche Regierung unter dem starken Einfluss der rechtsextremen Freiheitspartei ebenso von der Vorstellung einer multikulturellen Gesellschaft verabschiedet wie Frau Merkel. Der niederländische Fussball-Journalist Henk Spaan dazu: «Den Spielern selber ist dies egal. Sie gehören heute zu einer selbstbewussten Generation, auf dem Spielfeld sind sie sozusagen farbenblind. Sie glauben an sich, spielen ihr Spiel und es ihnen egal, welche Ansichten die Zuschauer über sie haben.»
Und die Schweizer Nati? Ein australischer Journalist machte sie an der letzten WM in Rio zu Weltmeistern, was den Anteil von Spielern mit ausländischen Wurzeln betrifft. Vor den Teams von Australien, Algerien und Bosnien-Herzegowina. Und das dürfte an dieser EM nicht sehr anders sein. Kein Wunder für ein Land, in dem über ein Viertel der Einwohner keinen Schweizer Pass haben und über 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mindestens einen Grosselternteil haben, die keine Schweizer waren. Und doch geht diese Offen- und Aufgeschlossenheit bei den Mehrheiten in Abstimmungen über Vorlagen mit Bezug auf Europa, Flüchtlinge und die Beziehungen zu Nichtschweizern immer wieder vergessen – was sogar dem australischen Journalisten aufgefallen war.
Schauen Sie doch mal, wie viele aus der Startelf am 11. Juni gegen Albanien in Lens noch dabei sein könnten, wenn alle Spieler mit ausländischen Eltern ausgesperrt würden? Oder wie viele bei den Albanern noch dabei wären, wenn jene nicht spielen könnten, die in der Schweiz ausgebildet worden sind? Die Transnationalität selbst der heutigen Nationalmannschaften ist ein Ausdruck der enormen Migration der vergangenen Jahrzehnte und der Multikulturalität unserer heutigen Gesellschaften. Das Denken und die Einstellung vieler Zuschauerinnen und Zuschauer müssen freilich noch in die Nachspielzeit, bis sie dies auch ausserhalb des Fussballfeldes leben und schätzen lernen können.
Andi Gross, (St-Ursanne), Politikwissenschaftler, während 24 Jahren International- und Europarat, FCB-Fan, begann als 18jähriger Gymischüler mit dem Schreiben über die 2.-Liga-Spiele des FC Kleinhüningen am Basler Dreiländereck.
E-Diaspora
-
 albgala 2024: Die Albanischen Sterne in der Schweiz Die albgala 2024: Albanische Persönlichkeiten des Jahres 2024 in der Schweiz, organisiert von der Medienplattform albinfo.ch, markiert einen...
albgala 2024: Die Albanischen Sterne in der Schweiz Die albgala 2024: Albanische Persönlichkeiten des Jahres 2024 in der Schweiz, organisiert von der Medienplattform albinfo.ch, markiert einen... -
 Alvin Karaqi, ein grosser Karate-Champion und ambitionierter Arzt in der Schweiz
Alvin Karaqi, ein grosser Karate-Champion und ambitionierter Arzt in der Schweiz -
 Gemeinsam für eine Welt ohne Gewalt gegen Frauen
Gemeinsam für eine Welt ohne Gewalt gegen Frauen -
 AlbGala-Abend von Albinfo.ch: Ein unvergessliches Erlebnis
AlbGala-Abend von Albinfo.ch: Ein unvergessliches Erlebnis -
 Mednest24“: Der Spitex-Dienst, der in der Schweiz auch auf Albanisch spricht
Mednest24“: Der Spitex-Dienst, der in der Schweiz auch auf Albanisch spricht
Leben in der Schweiz
-
 So präsentiert sich der Bundesrat 2025: Ein Bild der Vielfalt Wie jedes Jahr zum Jahreswechsel, veröffentlicht der Bundesrat ein offizielles Gruppenbild – doch das Bundesratsfoto 2025...
So präsentiert sich der Bundesrat 2025: Ein Bild der Vielfalt Wie jedes Jahr zum Jahreswechsel, veröffentlicht der Bundesrat ein offizielles Gruppenbild – doch das Bundesratsfoto 2025... -
 Schweiz präsidiert internationales Migrationsforum
Schweiz präsidiert internationales Migrationsforum -
 albgala 2024: Die Albanischen Sterne in der Schweiz
albgala 2024: Die Albanischen Sterne in der Schweiz -
 Karin Keller-Sutter zur Bundespräsidentin gewählt
Karin Keller-Sutter zur Bundespräsidentin gewählt -
VIDEO
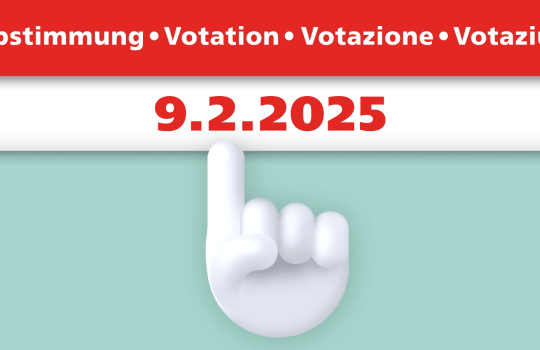 Die Erläuterungen des Bundesrates zum Abstimmungsvorlage vom 9. Februar 2025
Die Erläuterungen des Bundesrates zum Abstimmungsvorlage vom 9. Februar 2025